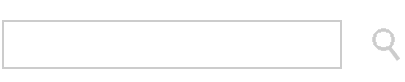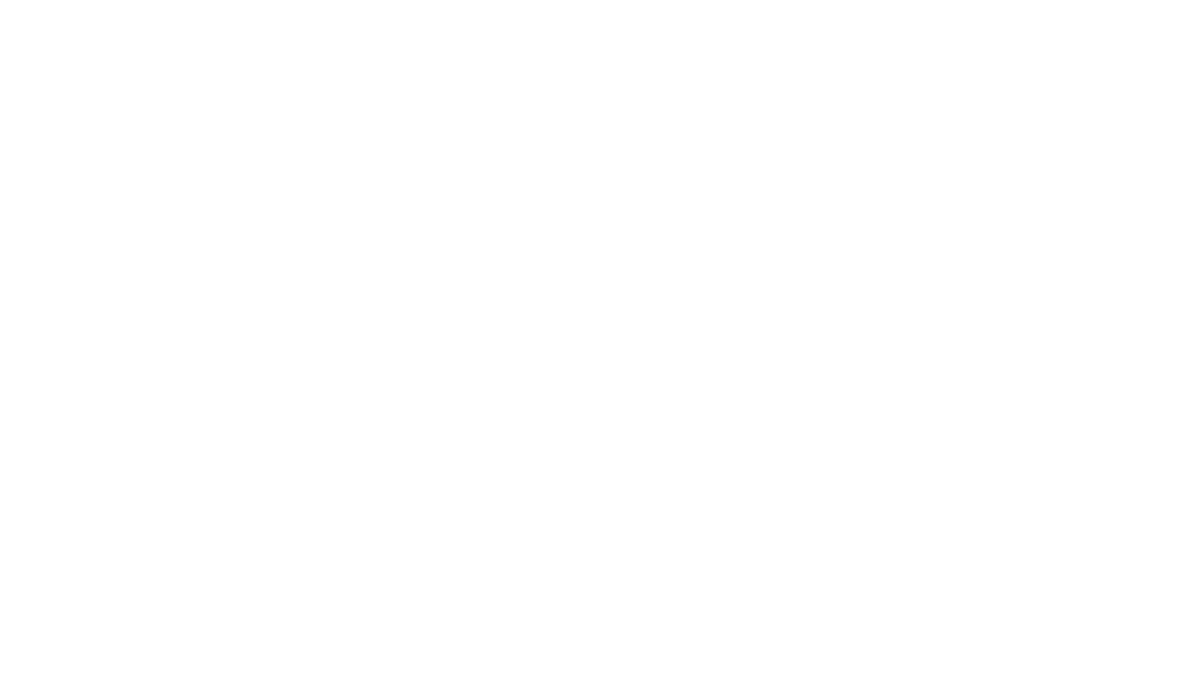Donett, Cornelius Andreas

Monogramm von Cornelius Andreas Donett auf einer von ihm geschaffenen Holzskulptur des hl. Nepomuk
© Kunstauktionshaus Schlosser GmbH & Co. KG, Bamberg.
Donett (auch: Donnet, Thonnet, Doneth, Donneth, Dennuth), Andreas, gen. Cornelius Andreas. Monogramm: CAD. Bildhauer. Kunsthändler. Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.~ 17.9.1683 Ffm., Diese Angaben konnten anhand von Dokumenten zweifelsfrei bestätigt werden.† 12.8.1748 Ffm.
Laut den amtlichen Quellen führte D. nur den Vornamen „Andreas“. Offenbar wählte er selbst später den Künstlernamen „Cornelius Andreas Donett“ mit dem Monogramm „CAD“, zumal das Monogramm „AD“ schon prominent (an Albrecht Dürer) vergeben war. Bei der Wahl des zweiten Vornamens dürfte der Name seines Paten, des Weinhändlers Andreas Cornelii (möglicherweise auch: Cornelius), eine Rolle gespielt haben.
Die Herkunft der Familie D. ist nicht geklärt. Möglicherweise stammte sie aus Frankreich. 1637 wurde der Kaufmann Anton Donnet aus Köln in der Karmeliterkirche in Ffm. begraben.
Sohn des Wollwebers Sigebert D. und dessen Ehefrau Anna Catharina, geb. Juncker (?-1712), einer Bäckerstochter aus Oberlahnstein. Die Eltern hatten am 15.5.1667 im Ffter Dom geheiratet. Geschwister: Johann Peter D. (1674-1720), Maler; Johann Edmund D. (1677-1697). Verheiratet (seit 1712) mit Eva Maria D., geb. Franck, Tochter des promovierten Chirurgen Johann Anton Franck (?-1709) aus Mainz. Zehn Kinder, die alle – wie schon D. selbst – im Ffter Dom getauft wurden: Maria Helena (* 1713), Anna Katharina (* 1714), Johann Peter (* 1716), Johann Peter (* 1717), Maria Margaretha (* 1718), Theodor (* 1720), Anna Gertrud (* 1721), Georg Friedrich (* 1723), Maria Magdalena (* 1726), Jacob Andreas (* 1728), von denen mindestens zwei Söhne und zwei Töchter das Erwachsenenalter erreichten; einer der Söhne trat in den Karmelitenorden ein und lebte unter dem Ordensnamen „Basilius“ im Ffter Karmeliterkloster.
Ab ca. 1695 war D., zunächst als Schüler, in der Werkstatt des Bildhauers Johann Wolfgang Frölicher (auch: Fröhlicher; 1652-1700) in Ffm. tätig, womit er während seiner Lehrzeit den „Großbetrieb“ eines weithin wirkenden Bildhauers kennenlernte. Nach Frölichers Tod ging D. als Geselle des Bildhauers Franz Matthias Hiernle (1677-1732) nach Mainz. Bei Hiernle, der seit 1705 Hofbildhauer des Mainzer Kurfürsten war, war D. wohl auch Meistergeselle. Während seiner Ausbildung arbeitete er u. a. nach Modellen des Niederländers Michael van Fuhrt, die in Frölichers Werkstatt in Ffm. entstanden waren. Am 5.6.1712 heirateten D. und Eva Maria Franck im Dom zu Mainz.
Spätestens seit April 1713 lebte D., als Beisasse und wohl als Bildhauermeister, wieder in Ffm. Wie eine Anzeige in den Ffter Frag- und Anzeigungsnachrichten vom 31.8.1731 belegt, war er zudem als Kunsthändler für Gemälde tätig. D. wohnte gegenüber dem Karmeliterkloster in der Alten Mainzer Gasse, wo er auch seine Werkstatt und seine „Kunsthandlung“ hatte. Zu seinen Schülern gehörten u. a. Johann Michael Datzerat, Johann Michael Aufmuth (um 1710-1756) sowie sein Sohn Georg Friedrich D. (1723-1774) und sein Schwiegersohn Peter Heinrich Hencke (1715-1777). Während der Kaiserwahl 1742 trat D. als Zeuge im Fall einer Beschwerde des Priors des Karmeliterklosters über die Einquartierung von kursächsischen Truppen während der Wahl- und Krönungsfeierlichkeiten in Ffm. auf. D. starb im Alter von 64 Jahren am 12.8.1748 an einem Schlaganfall und wurde am 14.8.1748 in der Karmeliterkirche bestattet. In dem Eintrag im Begräbnisbuch der Karmeliterkirche wird er „Sculptator celebris“ (berühmter, gefeierter Bildhauer) genannt. Wohl in derselben Grablege in der Karmeliterkirche (vor dem Marienaltar) wurden schon sein Bruder Johann Peter D. (1720) und später sein Sohn Georg Friedrich D. (1774) bestattet.
Wie sein Lehrer Johann Wolfgang Frölicher war D. ein begabter Vertreter der Bildhauerkunst des deutschen Barocks in Ffm. Er bearbeitete verschiedenste Materialien wie Stein, Holz, Elfenbein, Alabaster, und zwar sowohl in Groß- als auch in Kleinskulptur. So fertigte er etwa Architekturteile, sakrale Kunst und anspruchsvolle Gartenskulpturen. Um 1730 war D. maßgeblich an der barocken Innenausstattung der Deutschordenskirche und der (1803 abgebrochenen) Kapuzinerkirche in Ffm. beteiligt, für die er jeweils die Figuren für den Hochaltar schuf. Der Ffter Kunsthistoriker Henrich Sebastian Hüsgen pries ihn 1780 für seine „ausserordentliche Stärcke in Crucefix, sowohlen [in] Lebensgrös als im Kleinen aus Holtz“, weswegen er „den grosen Italiänern an der Seite zu stehen“ verdiene (Hüsgen: Nachrichten 1780, S. 150). D.s Meisterstück, ein Kruzifix aus Buchsbaumholz, ebenso wie ein von ihm geschaffenes Kruzifix in Miniatur von Elfenbein blieben lange in Familienbesitz und wurden erst 1843 auf der letzten Auktion des Chandelle’schen Nachlasses von Johann Theodor Wiesen versteigert.
Werke von D. in Ffm. und Umgebung (in Auswahl): Kruzifix in der Deutschordenskirche in Sachsenhausen (aus der Werkstatt von Johann Wolfgang Frölicher unter Mitarbeit von D., um 1696), Figuren im Treppenhaus des Deutschen Hauses in Sachsenhausen (Stein, um 1722-23; kriegszerstört, lediglich Fragmente der Allegorien der vier Kontinente im HMF erhalten), Epitaph (mit einer Figur „Fatica“) der Familie Vonderburg auf dem Ffter Peterskirchhof (zwischen 1723 und 1731; Entwurfsskizze im ISG; Grabmal bis 1945 erhalten, heute verschollen), Figuren der heiligen Elisabeth und des heiligen Georg in der Deutschordenskirche in Sachsenhausen (Holz, um 1729-32; ursprünglich für den Hochaltar, später auf der Orgelempore), Kruzifix für den Hochaltar der Kapuzinerkirche auf dem Gelände des Antoniterhofs in der Töngesgasse (um 1730; heute im Hochchor des Doms St. Bartholomäus), Figurenschmuck für die Kapuzinerkirche auf dem Gelände des Antoniterhofs in der Töngesgasse [Holz, um 1728-30; heute Kreuzigungsgruppe mit Jesus, Maria und Johannes vom Hochaltar in der Dreifaltigkeitskirche in Kelkheim-Fischbach/Taunus, Figuren der Maria mit Kind vom Muttergottesaltar und des hl. Florian in der Kirche St. Philippus und Jakobus in Glashütten-Schloßborn/Taunus), Figur „Christus als Gärtner“ im Garten des Kreuzgangs im Dominikanerkloster (um 1732; nicht erhalten), Figur des heiligen Florian im Dominikanerkloster in Ffm. (um 1732; nicht erhalten), Fassadenfigur des Kaisers Karl VII. für das Gasthaus „Zum Römischen Kaiser“ auf der Zeil (Stein, 1742-45; heute im HMF), Fassadenfigur des englischen Königs für das Gasthaus „Zum König von England“ in der Fahrgasse (Stein, um 1743; heute im HMF), Figurengruppe „Herkules und Antaeus im Kampf“ auf dem Springbrunnen am Roßmarkt in Ffm. (Brunnen entfernt für das Gutenbergdenkmal 1854, Figurengruppe nicht erhalten), Muttergottes mit Kind in der Kirche St. Vitus in (Kronberg-)Oberhöchstadt (gelber Sandstein, um 1715-45) sowie Gartenfiguren in Sandstein für Ffter Gärten, u. a. von Leerse, Belli, Malapert und Loën [davon vier Allegorien der schönen Künste aus dem Brentano’schen Garten in Rödelheim sowie vier Figuren antiker Gottheiten und zwei Vasen aus dem Loën’schen Garten an der Windmühle heute (seit 2017) in der Skulpturengalerie an der Südfassade des Neubaus vom HMF].
Werke von D. in Museen außerhalb von Ffm.: Gartenskulptur „Venus und Amor“ (zugeschrieben; Sandstein) im Rijksmuseum Amsterdam, Gartenfiguren „Frühling“ und „Sommer“ (signiert mit CAD; Sandstein) im Stadtmuseum Düsseldorf, Figur „Trauernde Maria“ aus einer Kreuzgruppe (signiert mit CAD; Buchsbaumholz) im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Gartenskulptur „Atalante“ (zugeschrieben; Sandstein, um 1720-30) im Badischen Landesmuseum Karlsruhe.
Hüsgen besaß in seiner Kunstsammlung ein Werk von D.: eine etwa 28 Zentimeter große „Gruppe von grauen Alabastre in Rubens Geschmack (...), wie ein Satyr ein nackigtes Weib umarmet, von guter Zeichnung; Affect und Ausdruck sind ganz des Gegenstands gemäß, und geben ehrenvolle Beweise seiner Kenntniß im nackigten [d. i. der menschlichen Anatomie]“ (Hüsgen: Artist. Magazin 1790, S. 321).
Nach Hüsgen und Gwinner beschäftigte sich die Kunstwissenschaft lange Zeit nicht mit D.s künstlerischem Schaffen. Erst Ludwig Baron Döry (1924-2018), Kunsthistoriker am HMF, spürte den weit verstreuten Arbeiten von D. nach und entdeckte viele unbekannte Werke. Er brachte die erste künstlerische Gesamtschau D.s und besprach dessen Arbeitsweise. In ihrer Dissertation über D.s Lehrer Johann Wolfgang Frölicher (1999) hat die Mainzer Kunsthistorikerin Nicole Beyer weitere Werke aus dessen Werkstatt, insbesondere aus den Jahren zwischen 1695 und 1700, mit D. in Verbindung gebracht und diesem zugeschrieben.
D.s Bruder Johann Peter D. (1674-1720), seit 1714 Ffter Bürger, war Porträtmaler und Wirt im Gasthof „Reifenberg“ in der Ffter Fahrgasse. Er arbeitete zeitweise mit dem Maler Johann Wolfgang Rorschach (ca. 1690-1730) zusammen, mit dem er eng befreundet war; Rorschachs Tochter heiratete Johann Michael Datzerat, der wiederum Cornelius Andreas D.s Schüler war. Johann Peter D. fertigte 28 Heiligenbildnisse für den Kreuzgang der Dominikanerkirche (1707) sowie Brustbilder von Christus und Maria links und rechts der Orgel in der Liebfrauenkirche.
D.s Tochter Maria Helena D. (1713-1758) heiratete 1740 in Ffm. den aus Geseke/Westfalen stammenden Bildhauer Peter Heinrich Hencke (1715-1777), einen Schüler ihres Vaters sowie späteren Mainzer Hofbildhauer. Hencke war wohl ab spätestens Ende der 1730er Jahre Geselle bei D. gewesen und hatte in dessen Werkstatt auch den Bildhauer Johann Michael Aufmuth kennengelernt, der später sein Trauzeuge wurde. Möglicherweise war Hencke der Zeichenlehrer seines angeheirateten Neffen Andreas Joseph Chandelle. Das Meisterstück von Hencke, eine elfenbeinerne Kreuzigungsgruppe mit den Figuren von Christus und Maria, befand sich bis zur Versteigerung 1843 im Besitz der Familie Chandelle. Einige Elfenbein-Schnitzereien (u. a. „Der Raub der Sabinerinnen“, Relief, 1743, und eine Statuette des heiligen Nepomuk, um 1745-75), die sich heute im Victoria and Albert Museum in London befinden, werden Hencke zugeschrieben.
D.s Tochter Anna Gertrud D. (1721-1795) heiratete 1742 den Weinhändler Nicolas Chandelle (1706-1749) aus Cheratte bei Lüttich. Aus der Ehe stammten drei Söhne (und somit D.s Enkel), u. a. Andreas Joseph Chandelle (1743-1820), kaiserlicher Postbeamter und Maler, dessen Taufpate der Großvater Cornelius Andreas D. war, und Mattheus (auch: Matthäus) Georg (seit 1816: von) Chandelle (1745-1826), promovierter Theologe und seit 1818 Bischof von Speyer. Eine Tochter von Andreas Joseph Chandelle (und somit eine Urenkelin von D.) war die Ffter Malerin Dorothea Chandelle (1784-1866).
D.s Sohn und Schüler Georg Friedrich D. (1723-1774) führte den Bildhauerbetrieb und den Kunsthandel des Vaters in der Alten Mainzer Gasse fort. Er verkehrte im Freundeszirkel von Henrich Sebastian Hüsgen, Christian Georg Schütz d. Ä. und Niklas Vogt sowie seinem Neffen Andreas Joseph Chandelle. 1756 wurde er von dem hessen-darmstädtischen Hofmaler Johann Christian Fiedler (1697-1765) porträtiert. Georg Friedrich D., der unverheiratet blieb, gehörte zu den Gewährsleuten für Hüsgens später erschienene „Nachrichten von Franckfurter Künstlern und Kunst-Sachen“ (1780).
D. besaß eine Kunstsammlung, die sein Sohn Georg Friedrich D. weiterführte und später an seinen Neffen Andreas Joseph Chandelle weitervererbte. Die Sammlung (mit ca. 300 Ölgemälden und Stichen) enthielt auch ein kleines Ölbild „Himmelfahrt Mariä, meisterlich kopiert nach Piazzetta“. Der Weinhändler Jacob Philipp Manskopf (seit 1840: Leerse gen. Manskopf; 1777-1859) erwarb in einer Auktion aus dem Nachlass von Andreas Joseph Chandelle am 21.8.1820 neben elf anderen Ölgemälden auch die kleine Ölskizze und vermachte sie später dem HMF (Inv.-Nr. B.1939.23). Wie von Gwinner berichtet, könnte die unsignierte Ölskizze das (spiegelverkehrte) Musterbild von Giovanni Battista Piazzetta (1682-1754) für seine Arbeit an dem großen Altarbild „Mariä Auferstehung und Himmelfahrt“ (1734/35) in der Deutschordenskirche in Sachsenhausen sein, das 1796 von französischen Truppen verschleppt wurde (heute im Louvre in Paris). D. hatte zwischen 1729 und 1732 selbst an der Altargestaltung in der Deutschordenskirche mitgearbeitet. Er könnte das kleine Musterbild erworben haben, als es nach der endgültigen Fertigstellung des Altarbilds nicht mehr benötigt wurde.
Die Herkunft der Familie D. ist nicht geklärt. Möglicherweise stammte sie aus Frankreich. 1637 wurde der Kaufmann Anton Donnet aus Köln in der Karmeliterkirche in Ffm. begraben.
Sohn des Wollwebers Sigebert D. und dessen Ehefrau Anna Catharina, geb. Juncker (?-1712), einer Bäckerstochter aus Oberlahnstein. Die Eltern hatten am 15.5.1667 im Ffter Dom geheiratet. Geschwister: Johann Peter D. (1674-1720), Maler; Johann Edmund D. (1677-1697). Verheiratet (seit 1712) mit Eva Maria D., geb. Franck, Tochter des promovierten Chirurgen Johann Anton Franck (?-1709) aus Mainz. Zehn Kinder, die alle – wie schon D. selbst – im Ffter Dom getauft wurden: Maria Helena (* 1713), Anna Katharina (* 1714), Johann Peter (* 1716), Johann Peter (* 1717), Maria Margaretha (* 1718), Theodor (* 1720), Anna Gertrud (* 1721), Georg Friedrich (* 1723), Maria Magdalena (* 1726), Jacob Andreas (* 1728), von denen mindestens zwei Söhne und zwei Töchter das Erwachsenenalter erreichten; einer der Söhne trat in den Karmelitenorden ein und lebte unter dem Ordensnamen „Basilius“ im Ffter Karmeliterkloster.
Ab ca. 1695 war D., zunächst als Schüler, in der Werkstatt des Bildhauers Johann Wolfgang Frölicher (auch: Fröhlicher; 1652-1700) in Ffm. tätig, womit er während seiner Lehrzeit den „Großbetrieb“ eines weithin wirkenden Bildhauers kennenlernte. Nach Frölichers Tod ging D. als Geselle des Bildhauers Franz Matthias Hiernle (1677-1732) nach Mainz. Bei Hiernle, der seit 1705 Hofbildhauer des Mainzer Kurfürsten war, war D. wohl auch Meistergeselle. Während seiner Ausbildung arbeitete er u. a. nach Modellen des Niederländers Michael van Fuhrt, die in Frölichers Werkstatt in Ffm. entstanden waren. Am 5.6.1712 heirateten D. und Eva Maria Franck im Dom zu Mainz.
Spätestens seit April 1713 lebte D., als Beisasse und wohl als Bildhauermeister, wieder in Ffm. Wie eine Anzeige in den Ffter Frag- und Anzeigungsnachrichten vom 31.8.1731 belegt, war er zudem als Kunsthändler für Gemälde tätig. D. wohnte gegenüber dem Karmeliterkloster in der Alten Mainzer Gasse, wo er auch seine Werkstatt und seine „Kunsthandlung“ hatte. Zu seinen Schülern gehörten u. a. Johann Michael Datzerat, Johann Michael Aufmuth (um 1710-1756) sowie sein Sohn Georg Friedrich D. (1723-1774) und sein Schwiegersohn Peter Heinrich Hencke (1715-1777). Während der Kaiserwahl 1742 trat D. als Zeuge im Fall einer Beschwerde des Priors des Karmeliterklosters über die Einquartierung von kursächsischen Truppen während der Wahl- und Krönungsfeierlichkeiten in Ffm. auf. D. starb im Alter von 64 Jahren am 12.8.1748 an einem Schlaganfall und wurde am 14.8.1748 in der Karmeliterkirche bestattet. In dem Eintrag im Begräbnisbuch der Karmeliterkirche wird er „Sculptator celebris“ (berühmter, gefeierter Bildhauer) genannt. Wohl in derselben Grablege in der Karmeliterkirche (vor dem Marienaltar) wurden schon sein Bruder Johann Peter D. (1720) und später sein Sohn Georg Friedrich D. (1774) bestattet.
Wie sein Lehrer Johann Wolfgang Frölicher war D. ein begabter Vertreter der Bildhauerkunst des deutschen Barocks in Ffm. Er bearbeitete verschiedenste Materialien wie Stein, Holz, Elfenbein, Alabaster, und zwar sowohl in Groß- als auch in Kleinskulptur. So fertigte er etwa Architekturteile, sakrale Kunst und anspruchsvolle Gartenskulpturen. Um 1730 war D. maßgeblich an der barocken Innenausstattung der Deutschordenskirche und der (1803 abgebrochenen) Kapuzinerkirche in Ffm. beteiligt, für die er jeweils die Figuren für den Hochaltar schuf. Der Ffter Kunsthistoriker Henrich Sebastian Hüsgen pries ihn 1780 für seine „ausserordentliche Stärcke in Crucefix, sowohlen [in] Lebensgrös als im Kleinen aus Holtz“, weswegen er „den grosen Italiänern an der Seite zu stehen“ verdiene (Hüsgen: Nachrichten 1780, S. 150). D.s Meisterstück, ein Kruzifix aus Buchsbaumholz, ebenso wie ein von ihm geschaffenes Kruzifix in Miniatur von Elfenbein blieben lange in Familienbesitz und wurden erst 1843 auf der letzten Auktion des Chandelle’schen Nachlasses von Johann Theodor Wiesen versteigert.
Werke von D. in Ffm. und Umgebung (in Auswahl): Kruzifix in der Deutschordenskirche in Sachsenhausen (aus der Werkstatt von Johann Wolfgang Frölicher unter Mitarbeit von D., um 1696), Figuren im Treppenhaus des Deutschen Hauses in Sachsenhausen (Stein, um 1722-23; kriegszerstört, lediglich Fragmente der Allegorien der vier Kontinente im HMF erhalten), Epitaph (mit einer Figur „Fatica“) der Familie Vonderburg auf dem Ffter Peterskirchhof (zwischen 1723 und 1731; Entwurfsskizze im ISG; Grabmal bis 1945 erhalten, heute verschollen), Figuren der heiligen Elisabeth und des heiligen Georg in der Deutschordenskirche in Sachsenhausen (Holz, um 1729-32; ursprünglich für den Hochaltar, später auf der Orgelempore), Kruzifix für den Hochaltar der Kapuzinerkirche auf dem Gelände des Antoniterhofs in der Töngesgasse (um 1730; heute im Hochchor des Doms St. Bartholomäus), Figurenschmuck für die Kapuzinerkirche auf dem Gelände des Antoniterhofs in der Töngesgasse [Holz, um 1728-30; heute Kreuzigungsgruppe mit Jesus, Maria und Johannes vom Hochaltar in der Dreifaltigkeitskirche in Kelkheim-Fischbach/Taunus, Figuren der Maria mit Kind vom Muttergottesaltar und des hl. Florian in der Kirche St. Philippus und Jakobus in Glashütten-Schloßborn/Taunus), Figur „Christus als Gärtner“ im Garten des Kreuzgangs im Dominikanerkloster (um 1732; nicht erhalten), Figur des heiligen Florian im Dominikanerkloster in Ffm. (um 1732; nicht erhalten), Fassadenfigur des Kaisers Karl VII. für das Gasthaus „Zum Römischen Kaiser“ auf der Zeil (Stein, 1742-45; heute im HMF), Fassadenfigur des englischen Königs für das Gasthaus „Zum König von England“ in der Fahrgasse (Stein, um 1743; heute im HMF), Figurengruppe „Herkules und Antaeus im Kampf“ auf dem Springbrunnen am Roßmarkt in Ffm. (Brunnen entfernt für das Gutenbergdenkmal 1854, Figurengruppe nicht erhalten), Muttergottes mit Kind in der Kirche St. Vitus in (Kronberg-)Oberhöchstadt (gelber Sandstein, um 1715-45) sowie Gartenfiguren in Sandstein für Ffter Gärten, u. a. von Leerse, Belli, Malapert und Loën [davon vier Allegorien der schönen Künste aus dem Brentano’schen Garten in Rödelheim sowie vier Figuren antiker Gottheiten und zwei Vasen aus dem Loën’schen Garten an der Windmühle heute (seit 2017) in der Skulpturengalerie an der Südfassade des Neubaus vom HMF].
Werke von D. in Museen außerhalb von Ffm.: Gartenskulptur „Venus und Amor“ (zugeschrieben; Sandstein) im Rijksmuseum Amsterdam, Gartenfiguren „Frühling“ und „Sommer“ (signiert mit CAD; Sandstein) im Stadtmuseum Düsseldorf, Figur „Trauernde Maria“ aus einer Kreuzgruppe (signiert mit CAD; Buchsbaumholz) im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Gartenskulptur „Atalante“ (zugeschrieben; Sandstein, um 1720-30) im Badischen Landesmuseum Karlsruhe.
Hüsgen besaß in seiner Kunstsammlung ein Werk von D.: eine etwa 28 Zentimeter große „Gruppe von grauen Alabastre in Rubens Geschmack (...), wie ein Satyr ein nackigtes Weib umarmet, von guter Zeichnung; Affect und Ausdruck sind ganz des Gegenstands gemäß, und geben ehrenvolle Beweise seiner Kenntniß im nackigten [d. i. der menschlichen Anatomie]“ (Hüsgen: Artist. Magazin 1790, S. 321).
Nach Hüsgen und Gwinner beschäftigte sich die Kunstwissenschaft lange Zeit nicht mit D.s künstlerischem Schaffen. Erst Ludwig Baron Döry (1924-2018), Kunsthistoriker am HMF, spürte den weit verstreuten Arbeiten von D. nach und entdeckte viele unbekannte Werke. Er brachte die erste künstlerische Gesamtschau D.s und besprach dessen Arbeitsweise. In ihrer Dissertation über D.s Lehrer Johann Wolfgang Frölicher (1999) hat die Mainzer Kunsthistorikerin Nicole Beyer weitere Werke aus dessen Werkstatt, insbesondere aus den Jahren zwischen 1695 und 1700, mit D. in Verbindung gebracht und diesem zugeschrieben.
D.s Bruder Johann Peter D. (1674-1720), seit 1714 Ffter Bürger, war Porträtmaler und Wirt im Gasthof „Reifenberg“ in der Ffter Fahrgasse. Er arbeitete zeitweise mit dem Maler Johann Wolfgang Rorschach (ca. 1690-1730) zusammen, mit dem er eng befreundet war; Rorschachs Tochter heiratete Johann Michael Datzerat, der wiederum Cornelius Andreas D.s Schüler war. Johann Peter D. fertigte 28 Heiligenbildnisse für den Kreuzgang der Dominikanerkirche (1707) sowie Brustbilder von Christus und Maria links und rechts der Orgel in der Liebfrauenkirche.
D.s Tochter Maria Helena D. (1713-1758) heiratete 1740 in Ffm. den aus Geseke/Westfalen stammenden Bildhauer Peter Heinrich Hencke (1715-1777), einen Schüler ihres Vaters sowie späteren Mainzer Hofbildhauer. Hencke war wohl ab spätestens Ende der 1730er Jahre Geselle bei D. gewesen und hatte in dessen Werkstatt auch den Bildhauer Johann Michael Aufmuth kennengelernt, der später sein Trauzeuge wurde. Möglicherweise war Hencke der Zeichenlehrer seines angeheirateten Neffen Andreas Joseph Chandelle. Das Meisterstück von Hencke, eine elfenbeinerne Kreuzigungsgruppe mit den Figuren von Christus und Maria, befand sich bis zur Versteigerung 1843 im Besitz der Familie Chandelle. Einige Elfenbein-Schnitzereien (u. a. „Der Raub der Sabinerinnen“, Relief, 1743, und eine Statuette des heiligen Nepomuk, um 1745-75), die sich heute im Victoria and Albert Museum in London befinden, werden Hencke zugeschrieben.
D.s Tochter Anna Gertrud D. (1721-1795) heiratete 1742 den Weinhändler Nicolas Chandelle (1706-1749) aus Cheratte bei Lüttich. Aus der Ehe stammten drei Söhne (und somit D.s Enkel), u. a. Andreas Joseph Chandelle (1743-1820), kaiserlicher Postbeamter und Maler, dessen Taufpate der Großvater Cornelius Andreas D. war, und Mattheus (auch: Matthäus) Georg (seit 1816: von) Chandelle (1745-1826), promovierter Theologe und seit 1818 Bischof von Speyer. Eine Tochter von Andreas Joseph Chandelle (und somit eine Urenkelin von D.) war die Ffter Malerin Dorothea Chandelle (1784-1866).
D.s Sohn und Schüler Georg Friedrich D. (1723-1774) führte den Bildhauerbetrieb und den Kunsthandel des Vaters in der Alten Mainzer Gasse fort. Er verkehrte im Freundeszirkel von Henrich Sebastian Hüsgen, Christian Georg Schütz d. Ä. und Niklas Vogt sowie seinem Neffen Andreas Joseph Chandelle. 1756 wurde er von dem hessen-darmstädtischen Hofmaler Johann Christian Fiedler (1697-1765) porträtiert. Georg Friedrich D., der unverheiratet blieb, gehörte zu den Gewährsleuten für Hüsgens später erschienene „Nachrichten von Franckfurter Künstlern und Kunst-Sachen“ (1780).
D. besaß eine Kunstsammlung, die sein Sohn Georg Friedrich D. weiterführte und später an seinen Neffen Andreas Joseph Chandelle weitervererbte. Die Sammlung (mit ca. 300 Ölgemälden und Stichen) enthielt auch ein kleines Ölbild „Himmelfahrt Mariä, meisterlich kopiert nach Piazzetta“. Der Weinhändler Jacob Philipp Manskopf (seit 1840: Leerse gen. Manskopf; 1777-1859) erwarb in einer Auktion aus dem Nachlass von Andreas Joseph Chandelle am 21.8.1820 neben elf anderen Ölgemälden auch die kleine Ölskizze und vermachte sie später dem HMF (Inv.-Nr. B.1939.23). Wie von Gwinner berichtet, könnte die unsignierte Ölskizze das (spiegelverkehrte) Musterbild von Giovanni Battista Piazzetta (1682-1754) für seine Arbeit an dem großen Altarbild „Mariä Auferstehung und Himmelfahrt“ (1734/35) in der Deutschordenskirche in Sachsenhausen sein, das 1796 von französischen Truppen verschleppt wurde (heute im Louvre in Paris). D. hatte zwischen 1729 und 1732 selbst an der Altargestaltung in der Deutschordenskirche mitgearbeitet. Er könnte das kleine Musterbild erworben haben, als es nach der endgültigen Fertigstellung des Altarbilds nicht mehr benötigt wurde.
Artikel aus: Frankfurter Personenlexikon, verfasst von Andreas Hohm.
Artikel in: Frankfurter Biographie 1 (1994), S. 162, verfasst von: Sabine Hock.
Lexika: Grohmann, Johann Gottfried: Neues Historisch-biographisches Handwörterbuch, oder kurzgefaßte Geschichte aller Personen, welche sich durch Talente, Tugenden, Erfindungen, Irrthümer, Verbrechen oder irgend eine merkwürdige Handlung von Erschaffung der Welt bis auf gegenwärtige Zeiten, einen ausgezeichneten Namen machten. Nebst unparteiischer Anführung dessen, was die scharfsinnigsten Schriftsteller über ihren Character, ihre Sitten und Werke geurtheilet haben. Bd. 1-7. Leipzig 1796-99. Fortsetzung: Fuhrmann, Wilhelm David: Die denkwürdigsten und verdienstvollsten Personen der alten und neuen Zeit als Anhang und Nachtrag zu J. G. Grohmanns historisch-biographisches Handwörterbuch. Bd. 7-10. Leipzig 1805-08.Grohmann/Fuhrmann: Neues Historisch-biographisches Handwörterbuch 10 (1808), S. 32. | Gwinner, Philipp Friedrich: Kunst und Künstler in Ffm. vom 13. Jahrhundert bis zur Eröffnung des Städel’schen Kunstinstituts. Ffm. 1862. Ergänzungsbd. Ffm. 1867.Gwinner, S. 236, 249-251, 256, 313. | Hellmann, Ullrich: Lexikon der Maler, Bildhauer, Goldschmiede, Vergolder, Goldschläger, Goldsticker, Kupferstecher, Buchdrucker, Kartenmacher, Juweliere und Diamantenschleifer des 18. Jahrhunderts in Mainz. 3 Teile. Mainz 2023.Hellmann: Lex. d. Maler, Bildhauer, Goldschmiede, Vergolder, Goldschläger, Goldsticker, Kupferstecher, Buchdrucker, Kartenmacher, Juweliere u. Diamantenschleifer d. 18. Jh.s in Mainz 2023, Teil 1, S. 101f.; Teil 3, S. 49, 55-57. | Hüsgen, Henrich Sebastian: Artistisches Magazin. Enthaltend Das Leben und die Verzeichnisse der Werke hiesiger und anderer Künstler. (...) Ffm. 1790.Hüsgen: Artist. Magazin 1790, S. 320-322. | Hüsgen, Henrich Sebastian: Nachrichten von Franckfurter Künstlern und Kunst-Sachen enthaltend das Leben und die Wercke aller hiesigen Mahler, Bildhauer, Kupfer- und Pettschier-Stecher, Edelstein-Schneider und Kunst-Gieser. Nebst einem Anhang von allem was in öffentlichen und Privat-Gebäuden merckwürdiges von Kunst-Sachen zu sehen ist. Ffm. 1780.Hüsgen: Nachrichten 1780, S. 150f., 180, 235, 270, 303. | Renkhoff, Otto: Nassauische Biographie. Kurzbiographien aus 13 Jahrhunderten. Wiesbaden 1985, 2., überarb. Aufl. 1992. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau XXXIX).NB 1992, S. 144, Nr. 804. | Schrotzenberger, Robert: Francofurtensia. Aufzeichnungen zur Geschichte von Ffm. 2., vermehrte u. verbesserte Aufl. Ffm. 1884.Schrotzenberger, S. 52. | Thieme, Ulrich/Becker, Felix: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. 37 Bde. Leipzig 1907-50.Thieme/Becker 9 (1913), S. 439.
Literatur: Alsheimer, Herbert (Hg.): Den Glauben bewahrt. 275 Jahre St. Vitus-Kirche in Oberhöchstadt. Ffm. 1998.Döry, Ludwig Baron: Die Madonna aus Sandstein des Bildhauers Cornelius Andreas Donett und andere Skulpturen des 18. Jahrhunderts. In: Alsheimer (Hg.): St. Vitus-Kirche in Oberhöchstadt 1998, S. 92-110, hier S. 93-95 (m. Abb. auf S. 99). | Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte nebst Berichten zur kirchlichen Denkmalpflege. Hg. im Auftr. d. Gesellschaft für Mittelrheinische Kirchengeschichte. Bisher 75 Bde. Mainz/Speyer 1949-2023.Döry, Ludwig Baron: Der Bildhauer Cornelius Andreas Donett und sein Anteil an der Ausstattung der Ffter Kapuzinerkirche. In: Archiv f. mittelrhein. Kirchengeschichte 12 (1960), S. 304-312. | [Belli-Gontard, Marie:] Leben in Ffm. Auszüge der Frag- und Anzeigungs-Nachrichten (des Intelligenzblattes) von ihrer Entstehung an im Jahre 1722 bis 1821 gesammelt, geordnet und den Bürgern dieser Stadt gewidmet von Maria Belli, geb. Gontard. Zehn Bde. Ffm. 1850-51.Belli-Gontard: Leben in Ffm. 1 (1850), S. 113. | Beyer, Nicole: Das Werk des Johann Wolfgang Frölicher. Ein Beitrag zur barocken Skulptur im Deutschland des 17. Jahrhunderts. Mainz 1999. (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 92).Beyer: Johann Wolfgang Frölicher 1999, S. 107, 134f., 150f., 235, 350f. | Bott, Barbara/Döry, Ludwig Baron: Die Steindenkmäler des Historischen Museums Ffm. Hg. v. HMF. Ffm. 1956. (Kleine Schriften des HMF 2).Bott/Döry: Steindenkmäler des HMF 1956, S. 24-27, 41f. | Döry, Ludwig Baron/Deneke, Bernward: Ffter Skulpturen im Historischen Museum Ffm. [Ausstellungskatalog. Fotografien: Fred Kochmann.] Ffm. 1959.Döry/Deneke: Ffter Skulpturen im HMF 1959. | Beiträge zur Geschichte des Niederrheins. Jahrbuch des Düsseldorfer Geschichtsvereins. 25 Jahrgänge. Düsseldorf 1886-1912. Fortgesetzt u. d. T.: Düsseldorfer Jahrbuch. Beiträge zur Geschichte des Niederrheins. Hg. v. Düsseldorfer Geschichtsverein. Bisher Jg. 26-94. Düsseldorf u. a. 1913-41 u. 1947-2024.Döry, Ludwig Baron: Signierte Plastiken des Ffter Barockbildhauers Cornelius Andreas Donett. Untersuchungen zu den Skulpturen vor Schloß Jägerhof in Düsseldorf. In: Düsseldorfer Jb. 50 (1960), S. 120-129. | Ffter Blätter für Familiengeschichte. Hg. v. Karl Kiefer. 7 Jahrgänge. Ffm. 1908-14.Stammbaum der Familie Chandelle. In: Ffter Bll. f. Familiengesch. 5 (1912), H. 3, S. 47. | Hartmann, Georg (Hg.)/Lübbecke, Fried (Bearb.): Alt-Fft. – Ein Vermächtnis. Ffm. [1950].Hartmann (Hg.)/Lübbecke (Bearb.): Alt-Fft. 1950, S. 238f. | Hüsgen, Henrich Sebastian: Getreuer Wegweiser von Ffm. und dessen Gebiete für Einheimische und Fremde. Ffm. 1802.Hüsgen: Getreuer Wegweiser von Ffm. 1802, S. 59. | Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen. Hg.: Hamburger Kunsthalle und Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg. 25 Bände. Hamburg 1945/47-80.Möller, Liselotte: Bildwerke in Stein, Holz, Ton, Elfenbein. 1600-1800. Erwerbungen 1950-59. In: Jb. d. Hamburger Kunstsammlungen 5 (1960), S. 238f. | Kern, Ursula (Hg.): Blickwechsel. Ffter Frauenzimmer um 1800. Historisches Museum, Ffm. Ffm. 2007.Kern (Hg.): Blickwechsel 2007, S. 308f. | Kunst in Hessen und am Mittelrhein. Hg.: Hessisches Landesmuseum Darmstadt (u. anfangs: Staatliche Kunstsammlungen Kassel). 37 Jahrgänge. Darmstadt 1961/62 (1962)-1996/97 (1998). Neue Folge. Bisher 12 Jahrgänge. Darmstadt 2005-19.Hohm, Andreas: Andreas Joseph Chandelle (1743-1820). Leben und Werk. In: Kunst in Hessen u. am Mittelrhein NF 9 (2016), S. 69-87. | Leeuwenberg, Jaap (Hg.): Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum. Catalogus. Amsterdam 1973.Leeuwenberg (Hg.): Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum 1973, S. 483, Nr. 843. | Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und Kunst. Archiv des Historischen Vereins für Unterfranken und Aschaffenburg / Freunde Mainfränkischer Kunst und Geschichte e. V., Würzburg. Bisher 75 Bde. Würzburg u. a. 1949-2023.Hohm, Andreas: Die Pastellporträts der fränkischen Weinhändlerfamilie Wiesen als Zeichen bürgerlichen Selbstbewusstseins kurz vor 1800. In: Mainfränkisches Jb. f. Geschichte u. Kunst 75 (2023), S. 255-268. | Mainzer Zeitschrift. Mittelrheinisches Jahrbuch für Archäologie, Kunst und Geschichte. Hg. v. Altertumsverein in Verbindung mit dem Landesmuseum, der Landesarchäologie (bis 2013), dem Stadtarchiv und der Stadtbibliothek Mainz. Bisher 118/119 Jahrgänge. Mainz 1906-2023/24.Hellmann, Ullrich: Informationen zu Leben und Werk des Mainzer Hofbildhauers Peter Heinrich Hencke. In: Mainzer Zs. 113 (2018), S. 337-341. | Mitteilungen aus dem Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg. Hg. v. Hans-Bernd Spies. Bisher 10 Bde. sowie Sonder- und Beihefte. Aschaffenburg 1983-2013.Hohm, Andreas: Neue Funde zu den Pastellmalern Andreas Joseph Chandelle (1743-1820) und Dorothea Chandelle (1784-1866) und ihren familiären Beziehungen zu Mainz und Aschaffenburg. In: Mitt. aus d. Stadt- u. Stiftsarchiv Aschaffenburg 15 (2022), S. 55-74. | Verzeichniß einer sehr schätzbaren Gemähldesammlung, welche in der zweiten Meßwoche [20. September] nächstkünftiger Herbstmesse dahier in Fft. durch die geschwornen Herren Ausrüfer öffentlich an die Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung versteig[er]t werden soll. Ffm. 1808.Versteigerungskat. Gemäldesammlung 1808, S. 15, Nr. 168. | Weizsäcker, Heinrich: Die Kunstschätze des ehemaligen Dominikanerklosters in Ffm. Nach den archivalischen Quellen bearb. u. hg. mit Unterstützung der Administration des Dr. Johann Friedrich Böhmerschen Nachlasses. 2 Teile (Text- und Tafelband). München 1923.Weizsäcker: Kunstschätze des Dominikanerklosters 1923, S. 41f.
Quellen: Diözesanarchiv Limburg.Begräbniseintrag des Kaufmanns Anton Donnet aus Köln, 1637: Diözesanarchiv Limburg, Sign. FDom K 50_1: Ffm.-Dompfarrei, Begräbnisse in der Karmeliterkirche 1637-1802, S. 1. | Diözesanarchiv Limburg.Heiratseintrag der Eltern Sigebertus Donnett und Anna Catharina Juncker, Ffm., 15.5.1667: Diözesanarchiv Limburg, Sign. FDom K 1_5: Ffm.-Dompfarrei, Taufbuch [sic!] 1623-65, Bl. 87v. | Diözesanarchiv Limburg.Taufeintrag des Enkels Andreas Joseph Chandelle (hier: Jandell), Ffm., geb. am 5.8.1743, get. am 6.8.1743: Diözesanarchiv Limburg, Sign. FDom K 3_2: Ffm.-Dompfarrei, Taufbuch 1717-53, Bl. 105r = S. 203, Nr. 1208. | ISG, Karmeliterkloster: Bücher (Best. H.13.17), 15.-18. Jh.; dazu Rep. 199 (revidiert 1987).ISG, Karmeliterkloster: Bücher 66, Bl. 137r, 382r. | ISG, Karmeliterkloster: Urkunden und Akten (Best. H.13.16), 1281-1814. ISG, Karmeliterkloster: Urkunden u. Akten 367 (Notariatsinstrument zur Beurkundung von Zeugenaussagen, u. a. von Andreas Donnet, über die Einquartierung von kursächsischen Truppen bei der Kaiserwahl und -krönung, 10.2.1742). | ISG, Bestand Nachlassakten (Best. H.15.15), 1813-1920; erschlossen über Archivdatenbank.ISG, Nachlassakten 1832/3.492 (Chandelle, Anna Rosina, geb. Wiesen, Witwe von Andreas Joseph Chandelle). | ISG, Dokumentationsmappe in der Sammlung S2 (mit Kleinschriften, Zeitungsausschnitten und Nekrologen zu einzelnen Personen und Familien).ISG, S2/6.181. | Ober-Postamts-Zeitung. Ffm. 1615-1866.Ober-Postamts-Zeitung, Nr. 141, 22.5.1843, S. 1184, Benachrichtigungen, Nr. [5767] (Anzeige zur „Versteigerung von Oel- und Pastell-Gemälden, Kupferstichen und Kunstsachen“ aus dem Nachlass von Anna Rosina Chandelle).
Internet: Badisches Landesmuseum Karlsruhe. https://katalog.landesmuseum.de/object/DCF5CBD52F12431BA1237CBEECBBE116-skulptur-atalante
Hinweis: Eintrag zur Skulptur „Atalante“ von Cornelius Andreas Donett im digitalen Katalog.Bad. Landesmuseum Karlsruhe, 26.6.2025. | Historisches Museum Fft. (HMF), Ffm. https://historisches-museum-frankfurt.de/de/architektur/skulpturengalerie
Hinweis: Artikel: Die Skulpturengalerie am Museumsplatz.HMF, 26.6.2025. | Rijksmuseum Amsterdam. https://id.rijksmuseum.nl/20036256
Hinweis: Eintrag zu Sandsteinskulptur „Venus und Amor“ von Cornelius Andreas Donett.Rijksmuseum Amsterdam, 26.6.2025. | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Hg.: Wikimedia Foundation Inc., San Francisco/Kalifornien (USA). https://de.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Andreas_Donett - https://de.wikipedia.org/wiki/Antoniterkirche_(Frankfurt_am_Main) -
Hinweis: Artikel über Cornelius Andreas Donett und über die Antoniter-/Kapuzinerkirche in Ffm.Wikipedia, 26.6.2025.
GND: 128752637 (Eintrag der Deutschen Nationalbibliothek).
© 2026 Frankfurter Bürgerstiftung und bei dem Autor/den
Autoren
Empfohlene Zitierweise:
Hohm, Andreas: Donett, Cornelius Andreas. In: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe), https://frankfurter-personenlexikon.de/node/2035
Stand des Artikels: 2.7.2025
Erstmals erschienen in Monatslieferung: 07.2025.